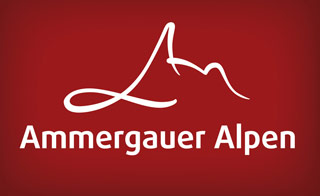KNIEENDOPROTHESE
Wenn das Kniegelenk ersetzt wird
Wer an einer rheumatischen Grunderkrankung leidet, hat oft früher oder später auch Probleme mit dem Kniegelenk. Bei Rheumatoider Arthritis ist dies bei rund 90% der Betroffenen der Fall.
Dass die Krankheit dank einer optimal eingestellten Basistherapie oder dank frühzeitig durchgeführter gelenkerhaltender operativer Maßnahmen zum Stillstand kommt, ist nicht immer zu erwarten.
Stattdessen wird häufig durch die anhaltende Entzündung der Gelenkknorpel geschwächt. Unabhängig vom weiteren Verlauf der Grunderkrankung kann es so zu einer Arthrose des Kniegelenks kommen.
Bestehend Belastungs-, Bewegungs- oder gar Ruheschmerzen und wird das Gehen zunehmend beschwerlicher, stellt sich – nachdem alle anderen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind – die Frage, ob eine Prothese die Lösung sein könnte.
Die Zahl der Kniegelenks-Endoprothesen hat in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen (90.000 im Jahr 2005 und 130.000 im Jahr 2006).
Welche Prothese ist die Richtige?
Die Besonderheiten des durch die rheumatische Erkrankung angegriffenen Gelenks stellen erhöhte Ansprüche an das operative Team. Es sollte Erfahrungen im Umgang mit rheumatischen Knochen haben, da die innere Struktur oft ausgedünnt und damit brüchig ist.
Beim Einsatz der Prothese wird so wenig Knochen wie möglich entfernt – so sind in späteren Jahren mehrere Prothesenwechsel möglich. Da die Bänder im Knie oft ebenfalls geschädigt sind und jederzeit wieder eine Entzündung auftreten kann, werden nur selten Teilprothesen eingesetzt.
Unter den Vollprothesen (Oberflächenersatz) sind solche mit mobiler Plattform in der Regel am besten geeignet. Diese Modelle sind gut für die Bewegungen des Knies geeignet und halten deshalb meist länger. Beim Einsatz einer solchen Prothese sollten die Seitenbänder und Kapseln des Knies weitgehend intakt sein.
Die Prothesen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt – Allergien sollten vorher abgeklärt werden.
Die ausgedünnte Knochenstruktur zwingt meist dazu, das Implantat zu zementieren. Erlaubt es die Knochensubstanz, ist die zementfreie Verankerung vorzuziehen – hier muss weniger Knochen „geopfert“ werden.
In der Realität werden allerdings häufiger zementierte Versionen implantiert, da Rheumatiker das operierte Bein meist nicht über längere Zeit entlasten können, wie es eine zementfreie Prothese erfordern würde.
Welche Narkoseform ist geeignet?
Häufig ist die Halswirbelsäule ebenfalls von Rheumatoider Arthritis befallen. Das macht eine „normale“ Narkose risikoreich, da hier zur Beatmung der Kopf nach hinten überstreckt werden muss. Eine Betäubung über das Rückenmark (Spinal- oder Periduralanästhesie) hat den Nahteil, dass man weniger schnell wieder mobil ist – außerdem muss gegebenenfalls ein Blasenkatheter gelegt werden.
Bewährt hat sich die Regionalanästhesie des vorderen und hinteren Nervengeflechts am Oberschenkel. Nach der Operation können über diesen Zugang zudem gezielt die Schmerzmittel gegeben werden. (Lesen Sie einen Erfahrungsbericht dazu in mobil 6/07, Seite 18.)
Während und unmittelbar nach der Operation kann das Blut durch ein spezielles Gerät, einen Cellsaver, aufgefangen werden und „gereinigt“ als Konzentrat wieder zurückgegeben werden. So umgeht man die Eigenblutspende und die Fremdblutgabe.
Nach einer solchen Narkose kann in der Regel bereits am Operationstag mit der Physiotherapie begonnen werden.
Was passiert nach der Operation?
Die Hilfsmittel nach der Operation müssen individuell ausgewählt werden – je nachdem, welche Köperteile sonst noch betroffen sind. Infrage kommen zum Beispiel ein hoher Gehwagen, ein Rollator oder ein Elektrorollstuhl. Auf den Krankenhausaufenthalt sollte eine stationäre Rehabilitation folgen, um den Übergang in die häusliche Umgebung besser gestalten zu können. Aber auch ambulante Rehabilitationskonzepte lassen sich manchmal umsetzen.
Selten ist nur das Kniegelenk befallen – meist ist es eines unter mehreren betroffenen Gelenken. Deshalb muss die Knieprothese in ein Gesamtkonzept der operativen Behandlung eingebettet werden. Die gilt insbesondere bei ausgeprägter Vorfußdeformation, die vor einer Knie-OP nach Möglichkeit behandelt werden sollte.
In ganz seltenen Fällen kann es sich anbieten, gleichzeitig beide Kniegelenke zu ersetzen oder gleichzeitig Hüfte und Knie. Sind mehrere Gelenke befallen, stehen auf dem Behandlungsplan meist die „köpernahen“ Gelenke, wie Hüfte, an erster Stelle. Aber natürlich wird auch danach geurteilt, welche Gelenke die meisten Schmerzen bereiten und welche in ihrer Funktion am meisten eingeschränkt sind.
Grundsätzlich steht der Erhalt der Selbstversorgung an erster Stelle und das betrifft vor allem die Geh- und Stehfähigkeit.
Bevor Sie sich für die Operation entscheiden, sollten Sie einige Fragen klären:
Zementierte Prothese:
Bei der zementierten Version wird die Verbindung zwischen Knochen und Prothese durch einen „Knochenzement“ (ein spezieller Kunststoff) erreicht. Nachdem der Zement flüssig in den vorbereiteten Knochen eingebracht worden ist, werden die Prothesenteile eingepresst. Der Zement härtet innerhalb von 15 Minuten aus – in der Regel kann das Gelenk sofort nach der Operation belastet werden.
Zementfreie Prothese:
Die zementfreie Variante wird direkt mit ihrer Oberfläche im Knochen verankert. Dazu wird der Knochen sehr passgenau ausgehöhlt, es muss also weniger Knochen entfernt werden, als bei zementierten Modellen. Dann wird die Prothese fest im Knochen verkeilt – je nach Gelenk unter Umständen auch verschraubt. Dann muss der Knochen, wie bei der Heilung eines Bruchs, an die Prothesenoberfläche heranwachsen und den verbliebenen schmalen Spalt zur Prothese überbrücken. Alle zementfreien Prothesen haben daher grobe oder feine Aufrauungen ihrer Oberfläche, an denen der heranwachsende Knochen Halt findet. Bis die Prothese eingewachsen ist, darf das Gelenk zunächst für einige Zeit nicht voll belastet werden.
Erschienen in "mobil" (Magazin der Deutschen Rheumaliga) 1/08 – Autor Dr. med. Martin Arbogast, Chefarzt der Klinik für Rheumaorthopädie und Handchirurgie
Stattdessen wird häufig durch die anhaltende Entzündung der Gelenkknorpel geschwächt. Unabhängig vom weiteren Verlauf der Grunderkrankung kann es so zu einer Arthrose des Kniegelenks kommen.
Bestehend Belastungs-, Bewegungs- oder gar Ruheschmerzen und wird das Gehen zunehmend beschwerlicher, stellt sich – nachdem alle anderen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind – die Frage, ob eine Prothese die Lösung sein könnte.
Die Zahl der Kniegelenks-Endoprothesen hat in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen (90.000 im Jahr 2005 und 130.000 im Jahr 2006).
Welche Prothese ist die Richtige?
Die Besonderheiten des durch die rheumatische Erkrankung angegriffenen Gelenks stellen erhöhte Ansprüche an das operative Team. Es sollte Erfahrungen im Umgang mit rheumatischen Knochen haben, da die innere Struktur oft ausgedünnt und damit brüchig ist.
Beim Einsatz der Prothese wird so wenig Knochen wie möglich entfernt – so sind in späteren Jahren mehrere Prothesenwechsel möglich. Da die Bänder im Knie oft ebenfalls geschädigt sind und jederzeit wieder eine Entzündung auftreten kann, werden nur selten Teilprothesen eingesetzt.
Unter den Vollprothesen (Oberflächenersatz) sind solche mit mobiler Plattform in der Regel am besten geeignet. Diese Modelle sind gut für die Bewegungen des Knies geeignet und halten deshalb meist länger. Beim Einsatz einer solchen Prothese sollten die Seitenbänder und Kapseln des Knies weitgehend intakt sein.
Die Prothesen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt – Allergien sollten vorher abgeklärt werden.
Die ausgedünnte Knochenstruktur zwingt meist dazu, das Implantat zu zementieren. Erlaubt es die Knochensubstanz, ist die zementfreie Verankerung vorzuziehen – hier muss weniger Knochen „geopfert“ werden.
In der Realität werden allerdings häufiger zementierte Versionen implantiert, da Rheumatiker das operierte Bein meist nicht über längere Zeit entlasten können, wie es eine zementfreie Prothese erfordern würde.
Welche Narkoseform ist geeignet?
Häufig ist die Halswirbelsäule ebenfalls von Rheumatoider Arthritis befallen. Das macht eine „normale“ Narkose risikoreich, da hier zur Beatmung der Kopf nach hinten überstreckt werden muss. Eine Betäubung über das Rückenmark (Spinal- oder Periduralanästhesie) hat den Nahteil, dass man weniger schnell wieder mobil ist – außerdem muss gegebenenfalls ein Blasenkatheter gelegt werden.
Bewährt hat sich die Regionalanästhesie des vorderen und hinteren Nervengeflechts am Oberschenkel. Nach der Operation können über diesen Zugang zudem gezielt die Schmerzmittel gegeben werden. (Lesen Sie einen Erfahrungsbericht dazu in mobil 6/07, Seite 18.)
Während und unmittelbar nach der Operation kann das Blut durch ein spezielles Gerät, einen Cellsaver, aufgefangen werden und „gereinigt“ als Konzentrat wieder zurückgegeben werden. So umgeht man die Eigenblutspende und die Fremdblutgabe.
Nach einer solchen Narkose kann in der Regel bereits am Operationstag mit der Physiotherapie begonnen werden.
Was passiert nach der Operation?
Die Hilfsmittel nach der Operation müssen individuell ausgewählt werden – je nachdem, welche Köperteile sonst noch betroffen sind. Infrage kommen zum Beispiel ein hoher Gehwagen, ein Rollator oder ein Elektrorollstuhl. Auf den Krankenhausaufenthalt sollte eine stationäre Rehabilitation folgen, um den Übergang in die häusliche Umgebung besser gestalten zu können. Aber auch ambulante Rehabilitationskonzepte lassen sich manchmal umsetzen.
Selten ist nur das Kniegelenk befallen – meist ist es eines unter mehreren betroffenen Gelenken. Deshalb muss die Knieprothese in ein Gesamtkonzept der operativen Behandlung eingebettet werden. Die gilt insbesondere bei ausgeprägter Vorfußdeformation, die vor einer Knie-OP nach Möglichkeit behandelt werden sollte.
In ganz seltenen Fällen kann es sich anbieten, gleichzeitig beide Kniegelenke zu ersetzen oder gleichzeitig Hüfte und Knie. Sind mehrere Gelenke befallen, stehen auf dem Behandlungsplan meist die „köpernahen“ Gelenke, wie Hüfte, an erster Stelle. Aber natürlich wird auch danach geurteilt, welche Gelenke die meisten Schmerzen bereiten und welche in ihrer Funktion am meisten eingeschränkt sind.
Grundsätzlich steht der Erhalt der Selbstversorgung an erster Stelle und das betrifft vor allem die Geh- und Stehfähigkeit.
VOR DER OPERATION
Bevor Sie sich für die Operation entscheiden, sollten Sie einige Fragen klären:
- Wo soll ich mich operieren lassen?
- Wer soll mich operieren?
- Hat der Operateur Erfahrung mit solchen Operationen?
- Welches Prothesenmodell ist für mich geeignet?
- Welches Prothesenmaterial ist in meinem Fall das beste?
- Welche Narkoseform ist die richtige?
- Brauche ich eine Blutspende oder Blutersatzpräparate?
- Wie sieht die Schmerztherapie nach der Operation aus und vertragen sich die Medikamente mit meiner Grundmedikation?
- Sind die Bewegungsprogramme nach der Operation auf meine Bedürfnisse abgestimmt?
- Wie lange dauert es, bis ich wieder „auf den Beinen“ bin?
- Mit welchen Einschränkungen muss ich nach der Operation rechnen?
- Bekomme ich die passenden Hilfsmittel?
- Ist eine Rehabilitation erforderlich und in welcher Form?
- Habe ich ein Nachsorgekonzept und gibt es ein Gesamtkonzept für meine Grunderkrankung?
ZEMENTIERT ODER ZEMENTFREI?
Zementierte Prothese:
Bei der zementierten Version wird die Verbindung zwischen Knochen und Prothese durch einen „Knochenzement“ (ein spezieller Kunststoff) erreicht. Nachdem der Zement flüssig in den vorbereiteten Knochen eingebracht worden ist, werden die Prothesenteile eingepresst. Der Zement härtet innerhalb von 15 Minuten aus – in der Regel kann das Gelenk sofort nach der Operation belastet werden.
Zementfreie Prothese:
Die zementfreie Variante wird direkt mit ihrer Oberfläche im Knochen verankert. Dazu wird der Knochen sehr passgenau ausgehöhlt, es muss also weniger Knochen entfernt werden, als bei zementierten Modellen. Dann wird die Prothese fest im Knochen verkeilt – je nach Gelenk unter Umständen auch verschraubt. Dann muss der Knochen, wie bei der Heilung eines Bruchs, an die Prothesenoberfläche heranwachsen und den verbliebenen schmalen Spalt zur Prothese überbrücken. Alle zementfreien Prothesen haben daher grobe oder feine Aufrauungen ihrer Oberfläche, an denen der heranwachsende Knochen Halt findet. Bis die Prothese eingewachsen ist, darf das Gelenk zunächst für einige Zeit nicht voll belastet werden.
Erschienen in "mobil" (Magazin der Deutschen Rheumaliga) 1/08 – Autor Dr. med. Martin Arbogast, Chefarzt der Klinik für Rheumaorthopädie und Handchirurgie
Veröffentlicht am: 27.03.2008 / News-Bereich: Die Presse über uns